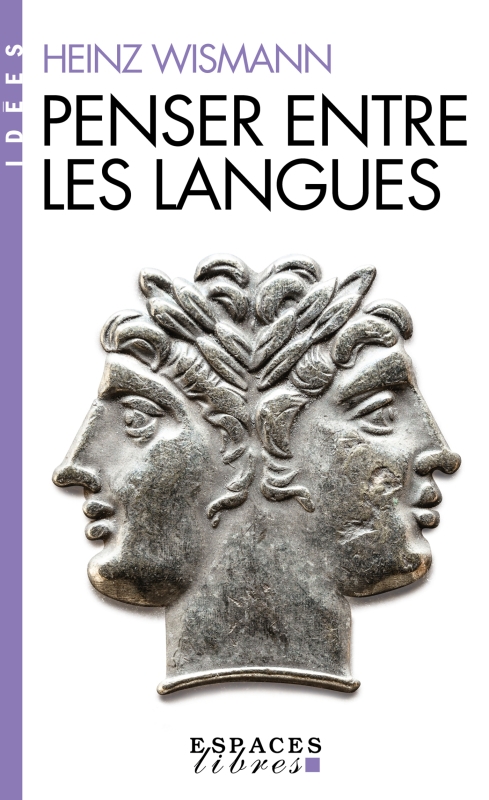In Anlehnung an die Frage „Lektüre muss sein! Welche?“ aus der Interviewreihe „3 ½ Fragen an …“ aus der ZEIT stellen in dieser Reihe Angehörige der Uni Münster Bücher oder Artikel vor, die für ihre Lehre oder Forschung wichtig sind, die sie im Studium beeinflusst haben oder die sie aus anderen Gründen für empfehlenswert halten – vielleicht auch als Feierabend- oder Urlaubslektüre. 🙂
Heinz Wismann
Penser entre les langues
Paris: Albin Michel 2012.
› der Band steht unter der Signatur Ph 8/124 in der Bibliothek des Romanischen Seminars zur Verfügung
Gerade weil nicht nur rein wissenschaftlich, sondern auch biographisch angelegt, möchte ich dieses Buch sehr empfehlen. Mit seinen Interviews ist es eigentlich ein ‹hingesprochenes› Buch: Manchmal hört man den homme de dialogue sprechen.
Mit dem eröffnenden Kapitel, „vagabondages autobiographiques“, erfährt der Leser Prägendes über Heinz Wismanns Lebens- und Bildungsweg. 1935 in Berlin geboren, Sohn eines frankophilen Kunsthistorikers und NS-Funktionärs, der 1944 im Krieg fiel, verbrachte der junge Wismann seine Kindheit auf der Flucht vor den Russen. Ende 1945 gelangt die Familie nach Münster zu einer streng katholischen Tante. Weder katholisch noch protestantisch, bezeichnet sich der junge Schüler naiv als gottgläubig. „Vagabundierende Religiosität“ hieß damals der soziologische Begriff für diese Einstellung. Wismann studierte dann Altphilologie und Philosophie an der Freien Universität Berlin, wo er 1956 den französischen Gräzisten Jean Bollack (1923–2012) kennenlernte. 1958 erhält er ein Stipendium von der Deutschen Studienstiftung. Mit Bollack ging er nach Lille, und Wismann wurde sein enger Mitarbeiter. 1960 entscheidet er sich für Paris als Lebensmittelpunkt und macht sich mit dem Philosophiemilieu der Sorbonne vertraut. So ist es wenig erstaunlich, dass er sich sein Leben lang für sprachliche Phänomenen begeisterte. Zwischen Altgriechisch, Deutsch und Französisch entfaltete er neue Denkmöglichkeiten. Anhand von Beispielen und Anekdoten fragt er sich in diesem Buch unter anderem: Wo stehen wir in Europa zwischen Sprachen, Kulturen und Interessen? Dieses „entre-deux“ ist kein vages Dazwischen, ein „Penser entre les langues“ ist nicht deckungsgleich mit „parler entre“. Jeder, der die Sprache wechselt, als Übersetzer oder Hermeneut, alle bewegen sich wie „Seiltänzer“ von einem Fixpunkt zum anderen. Eine solche akrobatische Bewegung kann man als Leitfaden für das Kulturverständnis des Autors verstehen, wobei „vagabonder“ hier nicht „errer“ heisst. Wenn man seine Heimat verlässt, wie der Wanderer der deutschen romantischen Tradition, entwickelt sich eine Disponibilität für das Neue. Das geistige Wandern wird Bildungsprinzip. Das Buch erklärt auch die besondere Zwischenposition, die Wismann im Fächerkanon der französischen Universität einnahm: Den Philosophen erschien er zu sehr als Philologe, den Gräzisten zu sehr als Philosoph. Weder den einen noch den anderen leuchtete ein, dass das „Zwischen“ ein Medium der Reflexivität sein sollte.
Eine jede Sprache eröffne einen Zugang zur Wirklichkeit: Sie sei eine Weltansicht, wie Wilhelm v. Humboldt sagte. Was für uns heute selbstverständlich ist, war es bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts nicht, als die Sprachen noch unter dem Ideal des Universalismus gedacht wurden. So beanspruchen Franzosen, ihre Sprache sei fähig, die lingua adamica am getreuesten nachzuahmen. Wegen ihrer Fähigkeit, Ideen klar und deutlich auszudrücken, sei sie der auf Gottesanweisung beruhenden Sprache des puren Benennens am nächsten. Wismann untersucht außerdem die Wirkung einer Begegnung im Jahr 1798 zwischen dem Abbé Sièyes, der sich als Revolutionär verstand, und dem Kantianer Humboldt, der Sièyes Kant erklären sollte. Dieser Begegnung war ein Sprachmissverständnis vorangegangen. Kant, als Vertreter der sogenannten „révolution copernicienne“, hatte schlicht von einer kopernikanischen „Wende“ (tournant) gesprochen. Nach einem siebenstündigen Gespräch musste der französischsprachige Humboldt aufgeben: Das Interesse, politischer Art einerseits, philosophischer Art andererseits, hätte nicht größer sein können. Ferner habe es keinen Sinn, Philosophie zu vermitteln, wenn Sprachbarrieren zu groß seien. Von nun an wird sich Humboldt, über den Unterschied der Vokabeln hinaus, für die Sprachenvielfalt und die Verschiedenheit ihres „Sprachbaus“ interessieren. Was er theoretisch weiterführen wird, hatte zur selben Zeit die Schweizerin Mme de Staël intuitiv entdeckt.
Bei einem Besuch bei Goethe war ihr aufgefallen, dass die Deutschen, hatten sie einmal das Wort ergriffen, sich nicht unterbrechen ließen. Weil es keine Unterbrechung gebe, sei keine Konversation möglich! Sie konnte sich diese Praxis nur durch eine Verschiedenheit der Syntax erklären. In zwei Kapiteln über „De l’esprit de conversation“ ihres Buches De l’Allemagne (1810) beschreibt sie, wie das, wovon die Rede ist, auf Deutsch immer nach dem kommt, was man davor sagt (wie beim Kompositum „Kaffeetasse“ (tasse à café) oder bei der Nachstellung des Verbs in Nebensätzen). Der Gesprächpartner ist dann zum Schweigen verurteilt. Daraus schließt sie, der Deutsche müsse etwas zu sagen haben oder so tun als ob, während man in den Pariser Salons „sprechen, ohne [etwas zu] sagen“ (d. h. causer) kann. Sie vermisse das Gezwitscher ihres Salons (man denke nur an das Twittern heutzutage!), wo alle gleichzeitig sprechen und sich dennoch alle verständigen. Die Stellung des Verbs am Ende ist aber nach Wismann nicht allein entscheidend: Das Verb habe auch mehr Aussagekraft. Auf Französisch dagegen ist es, als ob es stören würde: être ist meistens Kopula und verschwindet quasi zwischen Subjekt und Prädikat. So gesehen könne es nicht das „Sein“ der Heideggerschen Spekulation werden. Ein Indiz dafür, dass auf Deutsch das Wirken betont wird, ist, dass das Verb auch als Zeitwort bezeichnet wird: Der Wirklichkeitsbezug ist dann dynamisch, während das Französische sich auf eine réalité (vom lateinischem res, d. h. etwas Statisches) bezieht.
Wismann unterscheidet radikal vereinfachend zwischen denotativen und konnotativen Sprachgebrauch. Dem ersten Pol entsprechen die langues de services, Sprachen ohne Autoren und ohne Werke, wie die langues du paradis oder das aktuelle Globisch: Sie sind im Wesentlichen objektbezogen und allen gemeinsam. Dem anderen Pol gehören die historisch gewachsenen langues de culture an, die die subjektive Einstellung des Sprechers zur Wirklichkeit, d. h. das Meinen, widerspiegeln. Wismann macht den Unterschied am Beispiel von Heraklit fruchtbar. Gegen die Heideggersche Interpretation seiner Fragmente, hier spreche das „Sein“, argumentiert er, dass es nicht um eine Offenbarung gehe, sondern hier die Stimme von jemandem zu hören sei. Dank einer Aufmerksamkeit auf die veränderte Syntax – dabei geht es meistens um die Variationen feststehender Formulierungen – kommt der Hermeneut auf die Spur eines Meinens. Allgemeiner gesagt: Es wird der tradierten Grammatik etwas entnommen, das eine Besonderheit ausmacht. Eine ähnliche Situation beschreibt Wismann am Beispiel von Hölderlin, in der er sich als Dichter ebenfalls befindet: „entre les langues“, nämlich zwischen Altgriechisch und Deutsch. Eine ungewöhnliche dritte Sprache – ein hellenisiertes Deutsch – entsteht, das aus der Differenz zwischen der Muttersprache und der Herausforderung durch eine fremde Sprache resultiert. Rilke und Tsetaeva waren auch auf der Suche nach einer solchen poetischen Sprache in ihrer Muttersprache.
Solche Überlegungen haben wichtige Konsequenzen für die Erziehung. In den Schulsystemen Europas fehlt es immer mehr an einer Auseinandersetzung mit den historischen Kultursprachen. Viele junge Franzosen finden Balzac oder Molière schwer lesbar, weil ihnen oft nur noch Instrumente vermittelt werden, um einen Zeitungsartikel zu analysieren oder augenblicklich zu kommunizieren. Wenn man z.B. die Prosa Balzacs zu sehr vereinfacht, indem man sie auf den Informationswert ihrer Sätze reduziert, werde sie zu einer langue de service. Man lässt dann immer mehr das Konnotative, d.h. das subjektiv Gemeinte verkümmern. Eine Lehrerin aus der Sekundarstufe, Mireille Ko, hat 2000 ein lesenswertes Buch über die therapeutische Wirkung alter Sprachen veröffentlicht: Sie liege darin, dass sie einem ermöglicht, ältere Schichten in der Muttersprache zu entdecken. Diese Ablagerungen, die sich inzwischen auch in der bereits von manchen als tot deklarierten Prosa Balzacs gebildet haben, können im Licht der unmittelbaren Effizienz der Kommunikation einfach nicht beurteilt werden.
Wenn man in seinen Seminaren mit einer schwierigen Textpassage konfrontiert war, erinnerte Wismann gern an einen couragierten Spruch von Bollack: „Die Einen sagen so, die Anderen sagen so. Sie sehen […], man weiß es nicht“. Als Student in Lille am Centre de Recherche philologique, einem im Sinn einer kritischen Hermeneutik 1971 neugegründeten Zentrum, habe ich oft die Situation erlebt, dass man sich zunächst gestehen musste, nicht zu verstehen. An sich war die Mitteilung dieser Perplexität ein anspruchvolles Wissensprinzip. In den hochschulpolitischen Auseinandersetzungen des Mai 1968 bezogen Wismann und Bollack auch eine unkonventionelle und provokative Position für eine sogenannte „Befreiung der Varianten“ (gemeint waren die Varianten im kritischen Apparat der Editionen von griechischen Autoren, die bis dato nicht richtig berücksichtigt worden waren).
Wismann versteht Sprache in einem erweiterten Sinn: Sie impliziert für ihn auch Gestik. In dem rätselhaften Fragment 3 wird der liegende Heraklit gefragt, wie groß die Sonne sei. Gegen den zeitgenössischen spekulativen Diskurs, nach dem die Sonne zwölf Mal größer sei als sie erscheine, hebt Heraklit ironisch seinen Fuß, der dann die Sonne verbirgt und sagt, die Sonne habe die Größe eines Fußes. Sicher haben ehemalige Studenten noch das Bild des nachahmenden Wismann vor Augen.
Nicht nur in Lehre und Forschung, sondern auch in seiner Editionsarbeit macht Wismann Durchgänge möglich. 1986 griff er den Vorschlag der Dominikaner auf, eine neue Reihe unter dem Titel Passages in das Verlagsprogramm der éditions du Cerf aufzunehmen. Der Tagungsbericht eines Internationalen Kongresses zu dem Passagenwerk von Walter Benjamin stehen programmatisch für die Reihe, die an der Kreuzung zwischen Philosophie, Theologie und Sozialwissenschaften stattfand (jahrelang war Wismann Gastprofessor an der Pariser École des Hautes Études en Sciences Sociales). Innerhalb von zwanzig Jahren sind mehr als 150 Bände erschienen.
Es sprengte den Rahmen dieser Darstellung, würde man noch ein Kapitel wie « Homère versus Hésiode » präsentieren oder würde man der ungeteilten Aufmerksamkeit Wismanns auf die Musik Gehör schenken (er skizziert eine kurze Geschichte der westlichen Musik von Platon bis zum Rock ‚n‘ Roll, die auch eine Geschichte zu zähmender Dissonanzen ist). Auch die schwierigen Fragen bezüglich der Atomlehre Demokrits, nach der die Atome keine Körper seien, sondern Ideen, bedürften einer längeren Behandlung.
Wismann ist ein Mittler, der etwas zu sagen hat und am liebsten immer wieder mündlich vorträgt, z. B. im Radio bei France Culture, trotz der ständigen Unterbrechungen. Sein Buch ist ein Buch für Altphilologen, Sprachphilosophen, Linguisten, Poetologen, Kulturphilosophen und Pädagogen. Eine deutsche Übersetzung dieses Buches ist von großem Interesse.

Prof. Dr. Alain Deligne
Romanisches Seminar
aus den Publikationen:
Charger. L’idée de poids dans la caricature. Paris: L’Harmattan 2015.
(in der ULB in zwei Exemplaren verfügbar)