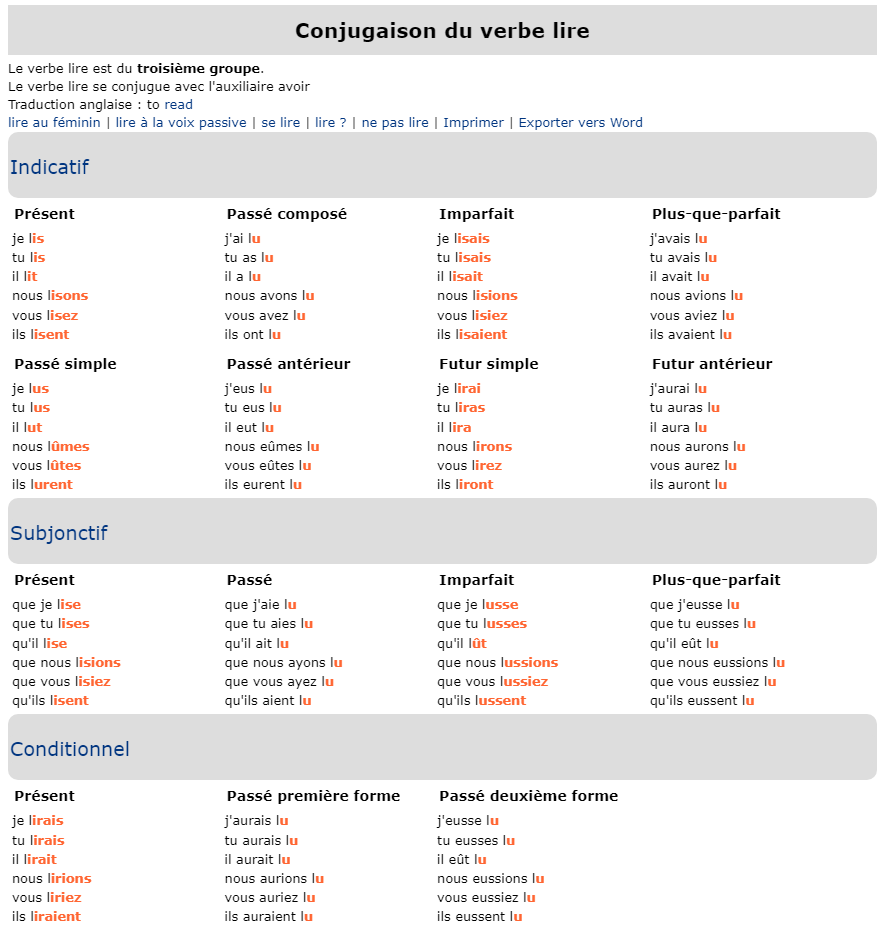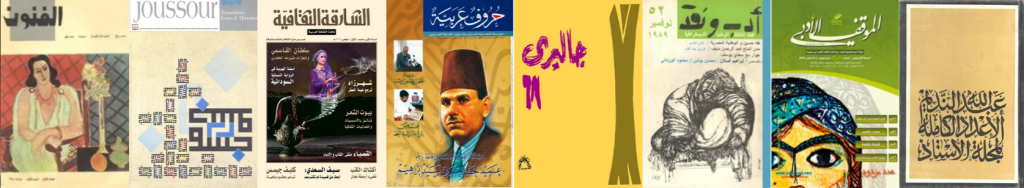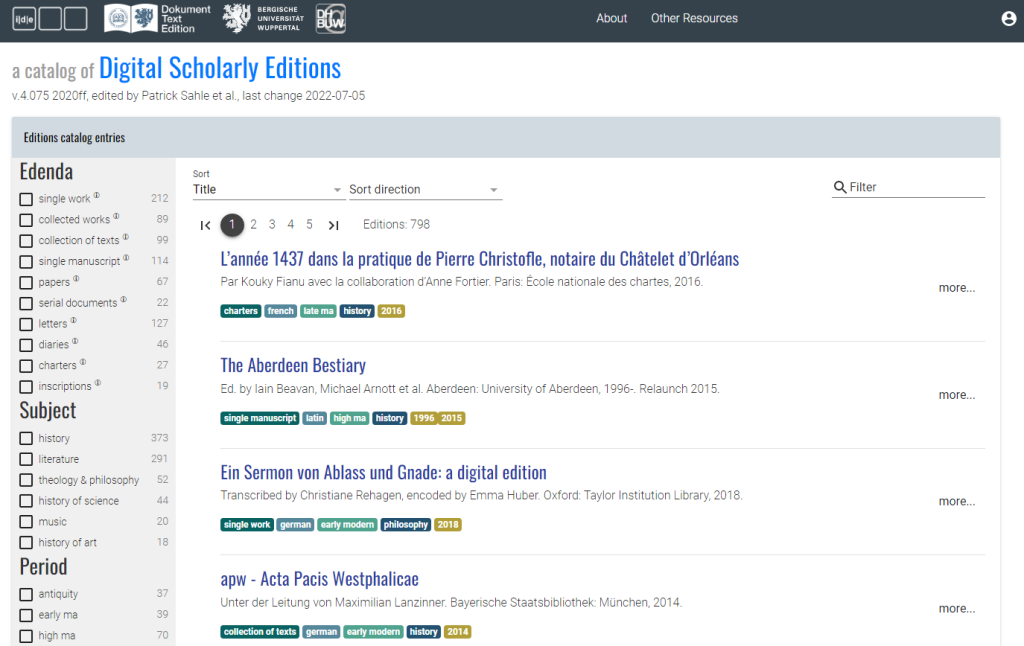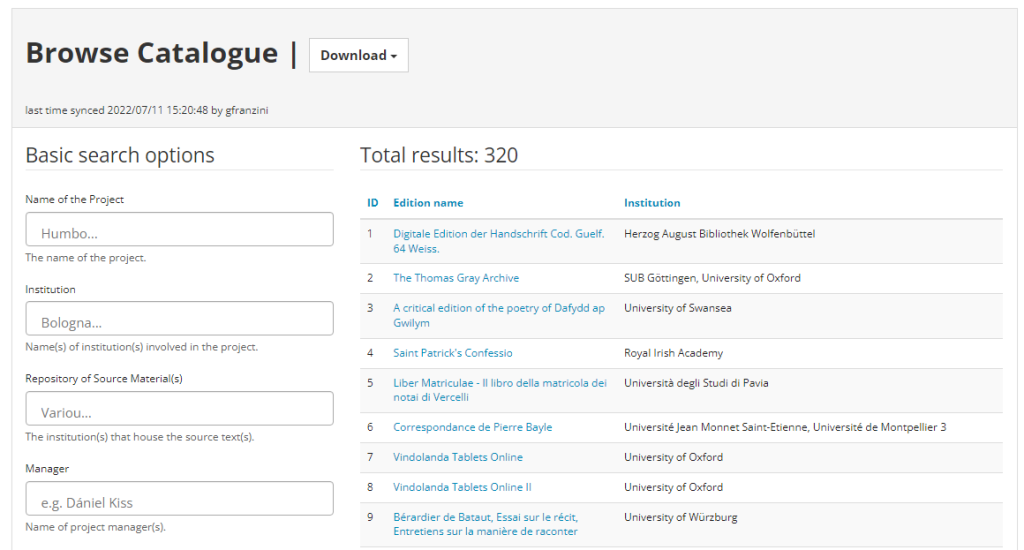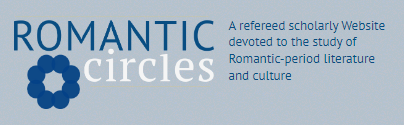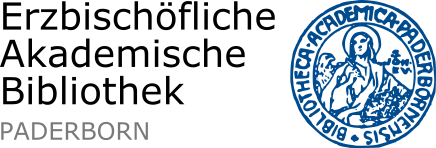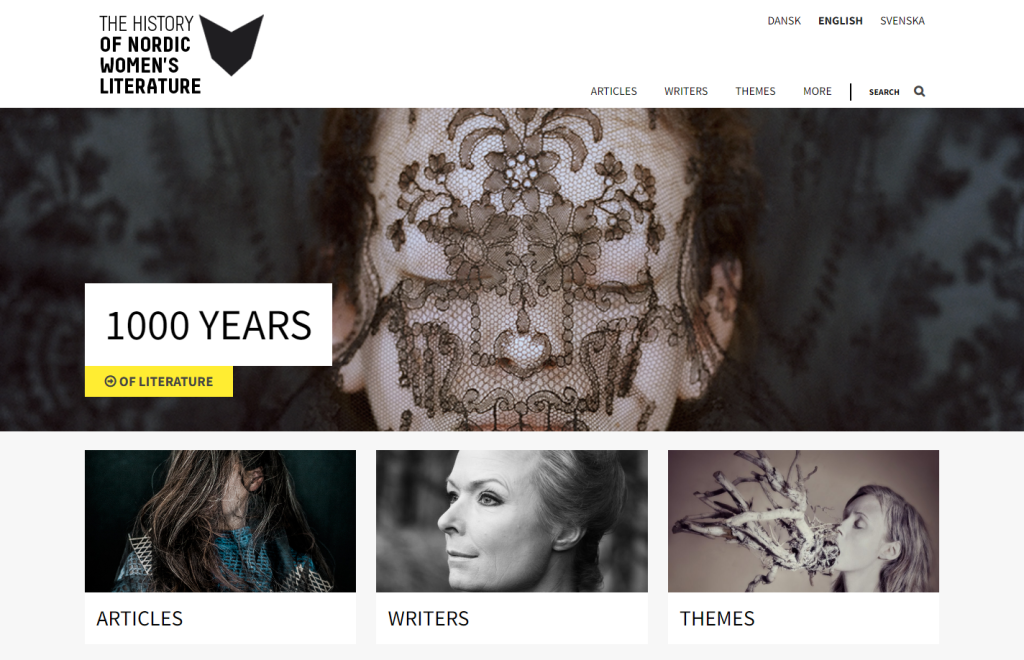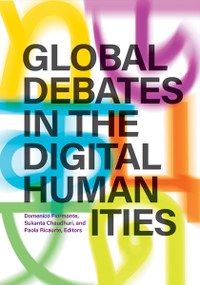Bayern2 radioWissen: „Molière – Meister der Charakterkomödien“
 „Der französische Komödiendichter Molière war ein mutiger Autor, der sich des Öfteren mit den Mächtigen seiner Zeit anlegte — und dabei nie seinen Humor verlor. Er machte die Komödie salonfähig. Bis heute ist er für seine Stücke wie „Tartuffe“ oder „Der eingebildete Kranke“ berühmt.“ (Bayern 2, Michael Reitz)
„Der französische Komödiendichter Molière war ein mutiger Autor, der sich des Öfteren mit den Mächtigen seiner Zeit anlegte — und dabei nie seinen Humor verlor. Er machte die Komödie salonfähig. Bis heute ist er für seine Stücke wie „Tartuffe“ oder „Der eingebildete Kranke“ berühmt.“ (Bayern 2, Michael Reitz)
Sie können die Sendung, die am 11.1.2022 auf Bayern 2 lief, über die Seite des BR nachhören oder als Audiodatei herunterladen.
WDR ZeitZeichen zu Moliere
 „Der Dichter und Schauspieler Jean-Baptiste Molière begeistert nicht nur Paris, Versailles und den Sonnenkönig. Er sorgt auch für einen Wendepunkt in der Kulturgeschichte.
„Der Dichter und Schauspieler Jean-Baptiste Molière begeistert nicht nur Paris, Versailles und den Sonnenkönig. Er sorgt auch für einen Wendepunkt in der Kulturgeschichte.
Seit der Antike gibt es im Theater zwei Kunstformen: die Tragödie und die Komödie. Lange Zeit gilt allerdings nur die Tragödie als großes Theater. Die Komödie ist etwas Minderes. Das ändert sich mit Jean-Baptiste Molière. Der französische Dichter und Schauspieler sorgt dafür, dass die Komödie heute gleichrangig neben der Tragödie steht.
Geboren wird der meisterhafte Komödiant am 15. Januar 1622 in Paris als Jean-Baptiste Poquelin. Sein Vater ist Handwerker und beruflich so erfolgreich, dass er sich „Tapezierer des Königs“ nennen darf. Über die Kindheit und Jugend von Jean-Baptiste ist wenig bekannt. Er soll bei den Pariser Jesuiten das Gymnasium absolviert haben.
Tour durch die Provinz
Statt die väterliche Tapetenfirma zu übernehmen, verliebt sich Jean-Baptiste in die Schauspielerin Madeleine Béjard und gründet mit ihr eine Schauspielertruppe. Sie nennt sich „l’Ilustre Théâtre“, „das berühmte Theater“. Er selbst wählt den Künstlernamen „De Molière“.
Weil die Truppe in Paris scheitert, sucht sie in der französischen Provinz nach Adeligen, die für eine Weile ein eigenes Theater haben möchten. Nach 13 Jahren Wanderschaft zeigt ein besonderer Mäzen Interesse: Herzog Philippe von Orléans, der Bruder des Sonnenkönigs. Er holt Molière nach Paris zurück.
„Truppe des Königs“
Ludwig XIV., selbst ein großer Spötter, ist vom Spott Molières so begeistert, dass seine Truppe 1665 zur „Troupe du Roy“ aufsteigt. Der König überlasst ihr die schönsten Säle in Paris. Molière gastiert im Louvre und in Versailles.
Außerdem erhält er die Bühne im Pariser Palais-Royal, auf der er bis zu seinem Tod seine Komödien aufführen kann. Er schreibt sie nicht nur selbst, er spielt sie auch in der Hauptrolle. Stücke wie „Der Menschenfeind“, „Der Geizige“ und „Tartuffe“ sind heute Klassiker.
Am Bluthusten erstickt
Auch ein weiteres Stück schreibt Geschichte: Am 17. Februar 1673 spielt Molière zum vierten Mal seine Komödie „Der eingebildete Kranke“. Plötzlich schüttelt ihn ein Hustenkrampf, Blut läuft ihm aus dem Mund. Die Aufführung wird abgebrochen. Zwei Stunden später stirbt Molière mit 51 Jahren.
Obwohl der Beruf des Schauspielers als „ehrlos“ gilt und daher eine christliche Beerdigung eigentlich ausgeschlossen ist, findet seine Witwe eine Lösung. Armande Béjard – die jüngere Schwester von Molières erster Liebe – bittet den König um Hilfe. Ludwig XIV. interveniert beim Erzbischof von Paris. Schließlich kann Molière doch in geweihter Erde bestattet werden, allerdings ohne Requiem.“ (WDR, Hans Conrad Zander, Hildegard Schulte)
Sie können die Sendung, die am 15.1.2022 in der Reihe „ZeitZeichen“ lief, über die Seite des WDR nachhören oder als Audiodatei herunterladen.
„Mehr als zehn Jahre lang arbeitete Tom Wolfe als Journalist und entwickelte seinen ganz eigenen Stil: Journalistische Genauigkeit und erzählerische Elemente. Dieser New Journalism zeichnet auch seinen ersten, im Jahr 1987 erschienenen Roman „Fegefeuer der Eitelkeiten“ aus.“