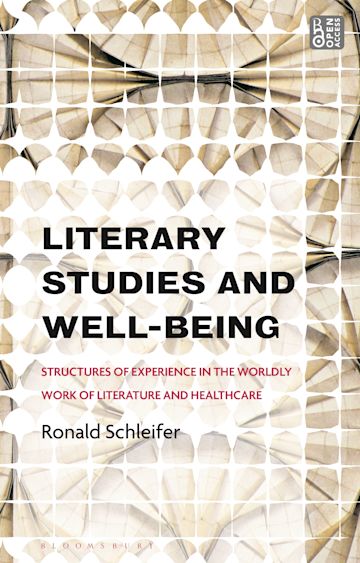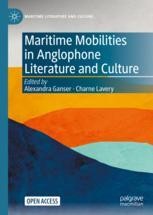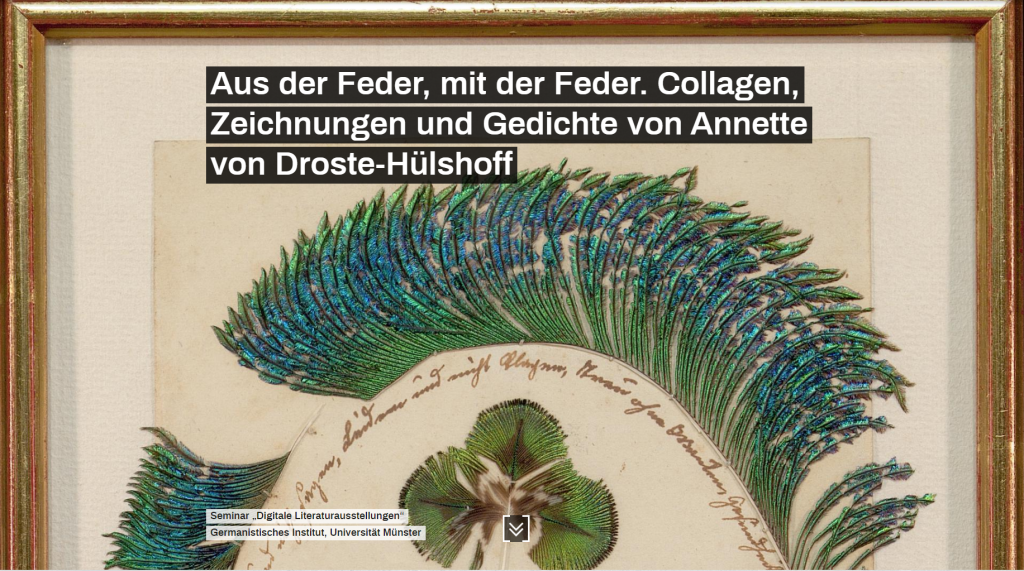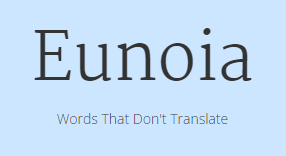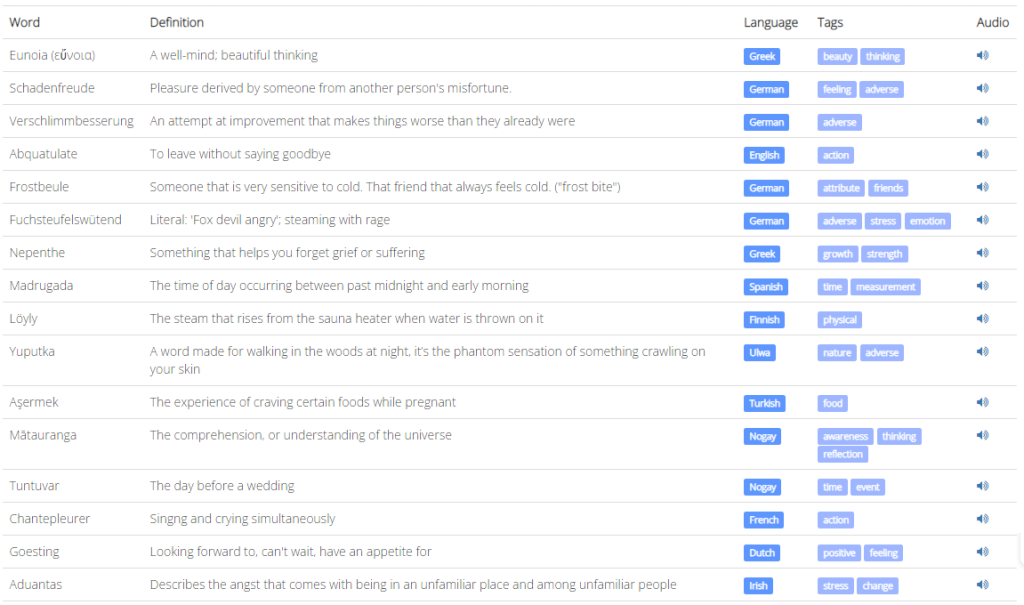![]() „Edvard Munch wusste, wie er sein Innerstes nach außen trägt. Das Leben des norwegischen Malers war von Krankheit und Tod geprägt. Das zeigte er auch in seinen Bildern. Damit löste er 1892 bei einer Ausstellung in Berlin einen Skandal aus.
„Edvard Munch wusste, wie er sein Innerstes nach außen trägt. Das Leben des norwegischen Malers war von Krankheit und Tod geprägt. Das zeigte er auch in seinen Bildern. Damit löste er 1892 bei einer Ausstellung in Berlin einen Skandal aus.
Edvard Munch wächst behütet in einem norwegischen Dorf auf. Er lernt aber auch schon früh, mit Tod und Trauer umzugehen. Seine Mutter stirbt 1868 an Tuberkulose. Edvard Munch ist zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt. Etwa neun Jahre später stirbt seine ältere Schwester an Schwindsucht, und seine jüngste Schwester hat schwere Depressionen.
Geprägt von Krankheit und Tod
Krankheit und Tod prägen das gesamte Leben von Edvard Munch. Das zeigt er auch in seinen Bildern. Mit seiner Kunst kann er nicht nur seine Erfahrungen, sondern auch sein großes Talent ausdrücken.
Der norwegische Maler ist einer der bedeutendsten Vertreter des Expressionismus, also einer Kunstrichtung, die eher Gefühle zum Ausdruck bringt, als es zum Beispiel beim Realismus der Fall war.
Das deutsche Kaiserreich ist aber von einer konservativen Grundhaltung geprägt. Kaiser Wilhelm II. legt 1901 fest, dass eine „Kunst, die sich über die von Mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt“, keine Kunst mehr sei, „sie ist Fabrikarbeit.„
Das führt dazu, dass vor allem Historienmalereien und Huldigungen produziert werden, die sich den Helden der Vergangenheit widmen. Die konservativen Malereien sollen die angeblich glorreiche Vergangenheit der Deutschen idealisieren.
Eine „anarchistische Provokation“ mit Wirkung
Als Edvard Munch 1892 in Berlin seine Bilder ausstellt, löst er damit einen Kunstskandal aus, den es in diesem Ausmaß bis dahin nicht gegeben hat. Die Bilder seien eine „anarchistische Provokation“, die sofort zu entfernen sei, hieß es.
Sieben Tage nach der Eröffnung wurde die Ausstellung im Architektenhaus in der Berliner Wilhelmstraße wieder geschlossen. Edvard Munch ist damit schlagartig berühmt und wird in den kommenden Jahren zu einem international bekannten Künstler.
Sein Bild „Der Schrei“ entsteht ungefähr ein Jahr nach der Ausstellung in Berlin und ist heute noch aktuell: Das angstvoll aufgerissene Gesicht zeigt nicht nur den außerordentlichen Schrecken, den das Gesicht sieht, sondern gewährt gleichzeitig einen ebenso erschreckenden Einblick in eine zutiefst verstörte Seele, die mit dem Gesehenen nicht zurechtkommt.
Ihr hört in Eine Stunde History:
- Skandinavist Ulrich Brömmling beschreibt die Zeit von Edvard Munch in Berlin.
- Kulturwissenschaftler und Munch-Biograf Hans Dieter Huber blickt auf die Hintergründe des Skandals der Ausstellung von Edvard Munch Anfang November 1892 in Berlin.
- Dlf-Kulturredakteur Stefan Koldehoff erläutert die Rolle und Bedeutung von Edvard Munch für den Expressionismus und die serielle Malerei.
- Deutschlandfunk-Nova-Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld erläutert die Stationen im Leben von Edvard Munch.
- Deutschlandfunk-Nova-Reporter Armin Himmelrath erinnert an den Skandal, der das deutsche Kaiserreich erschüttert hat.“
(Deutschlandfunk, Markus Dichmann, Matthias von Hellfeld)
Sie können die Sendung, die am 4.11.2022 auf Deutschlandfunk Nova lief, über die Seite des Senders nachhören oder als Audiodatei herunterladen.